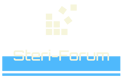Unser Anspruch...
Beratung und
Informationen
auf höchstem Level!
Auslegung, Bewertung und Überwachung
von Aufbereitungsprozessen in
ZSVA/AEMP, Endoskopie und Praxis

Unser Anspruch...
Endoskop-
Management
auf höchstem Level!
Testsysteme für Endoskope
Test, Überwachung und Bewertung
anhand der 6 wichtigsten Parameter

Unser Anspruch...
Prozess-
Überwachung
auf höchstem Level!
Überwachungssysteme für Reinigungs-
und Sterilisationsprozesse
Prozessüberwachung an der realen Leistungsgrenze
Fordern Sie uns...
Unsere Zielsetzung...
Normkonforme Aufbereitung für Alle
Damit eine Gesetzes- und Normkonforme Medizinprodukte-Aufbereitung gewährleistet werden kann, bedarf es einiger wichtiger Grundlagen.
Diese bekommen Sie bei uns aus erster Hand.
Fragen kostet nichts!
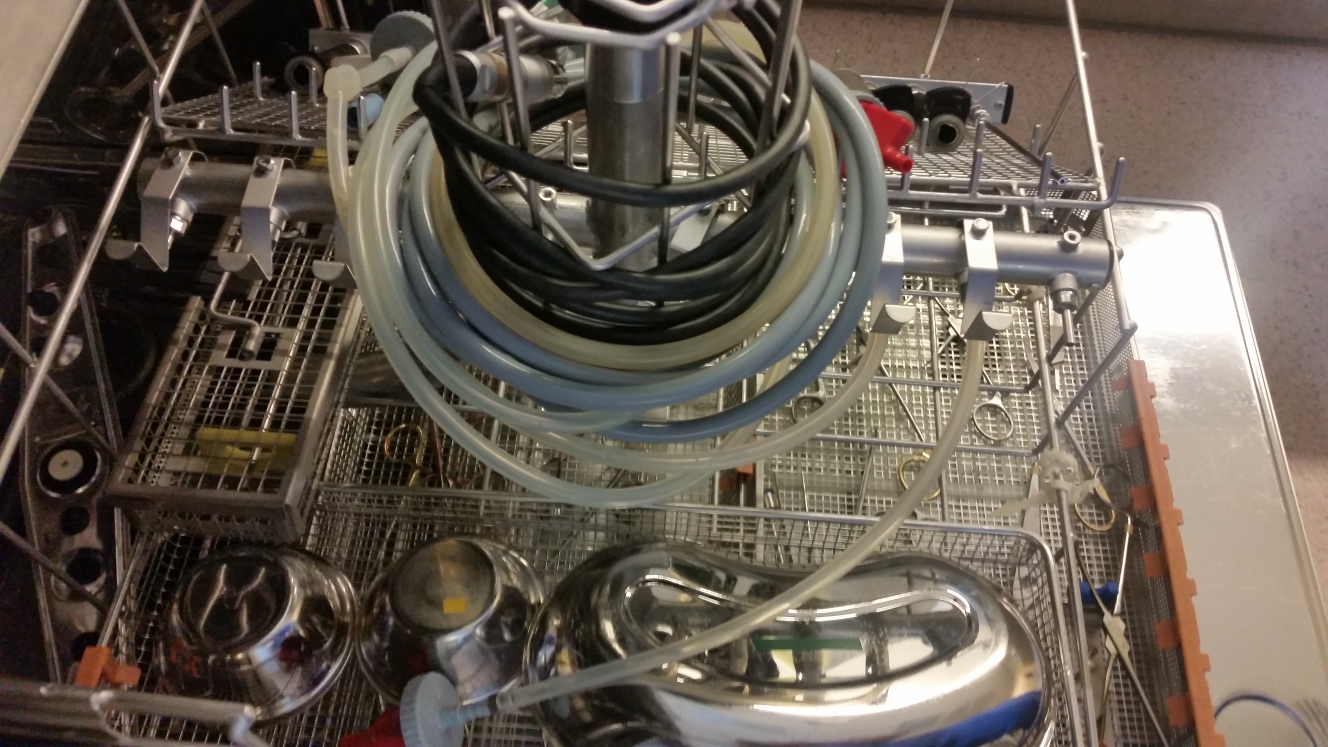
Unser Angebot...
der kostenlose Newsletter!
Immer up-to-date in Sachen Prozessüberwachung, Gesetze und Normen.
Sie können uns aber auch gerne weitere Nachrichten zukommen lassen.
Unser Alltag...
"...that´s life!"
Heiteres und spannendes von der Front
Manchmal ist es äußerst interessant, was einem unterwegs so alles passiert. In unserem Blog werden wir davon berichten.
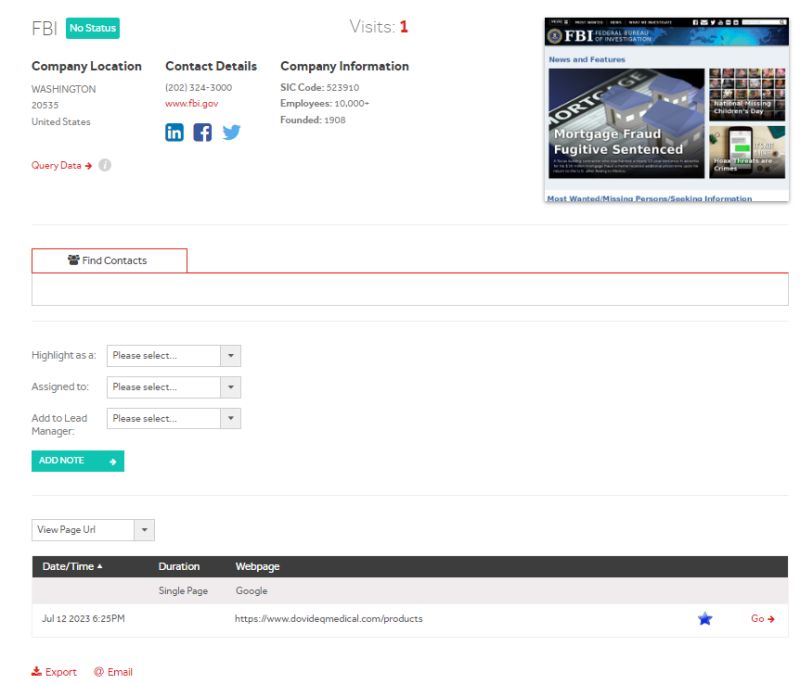
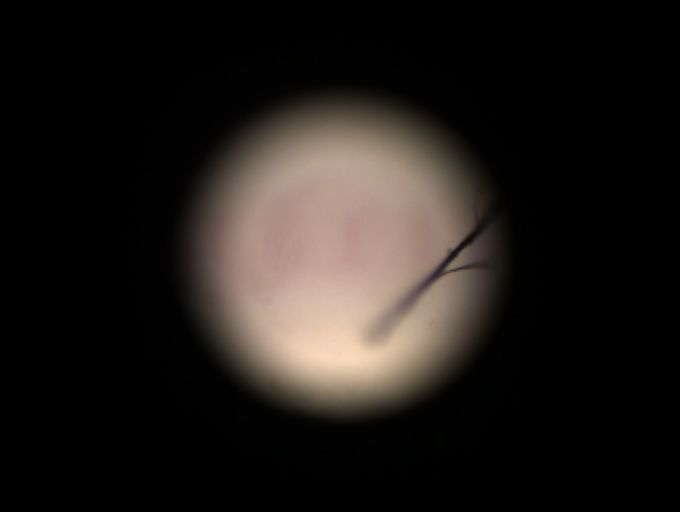
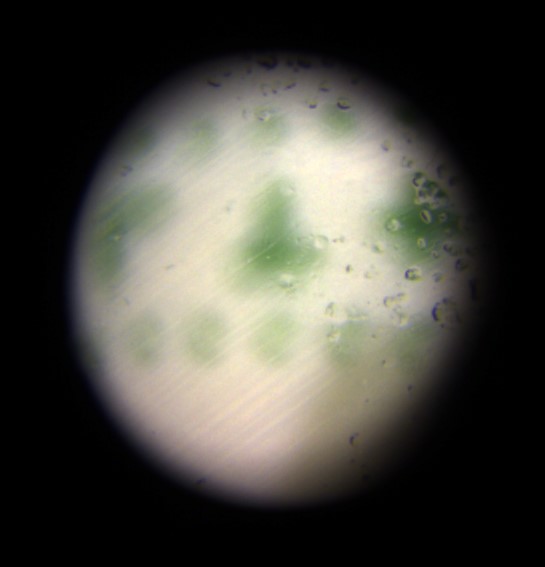
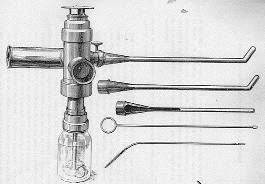

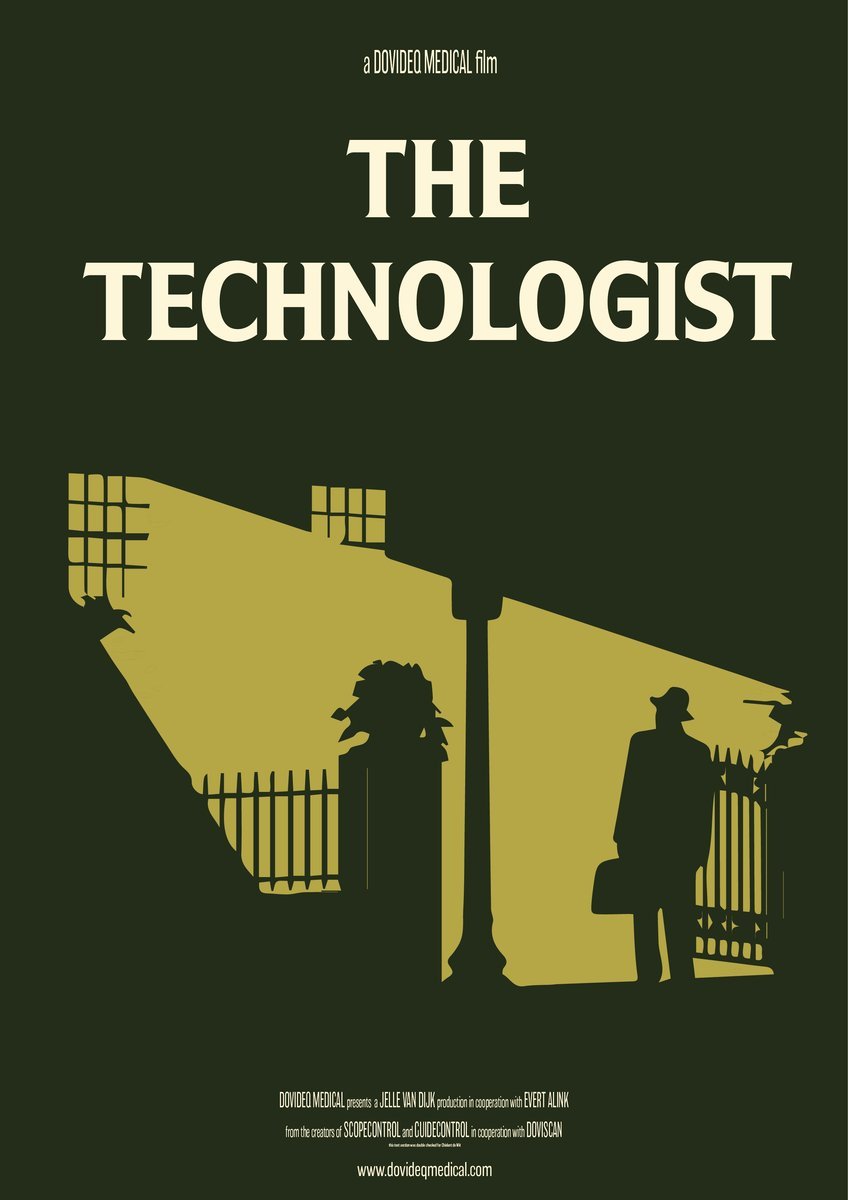
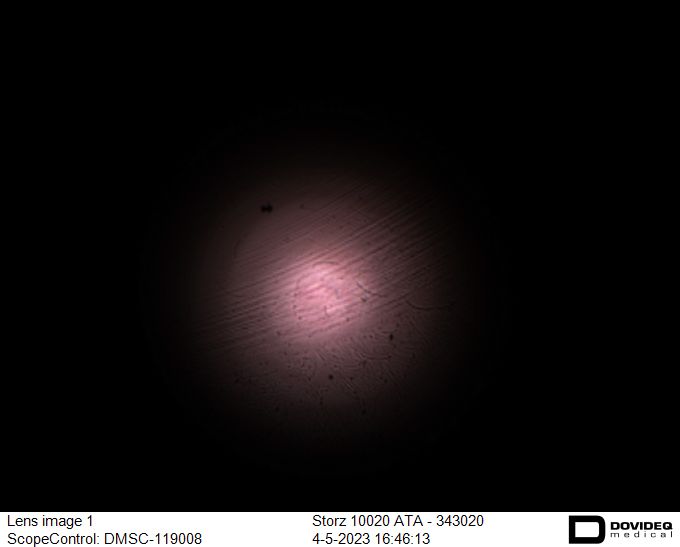
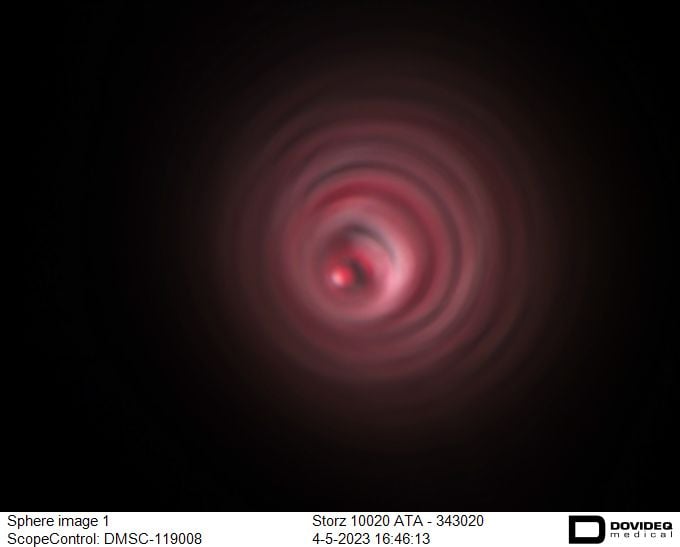
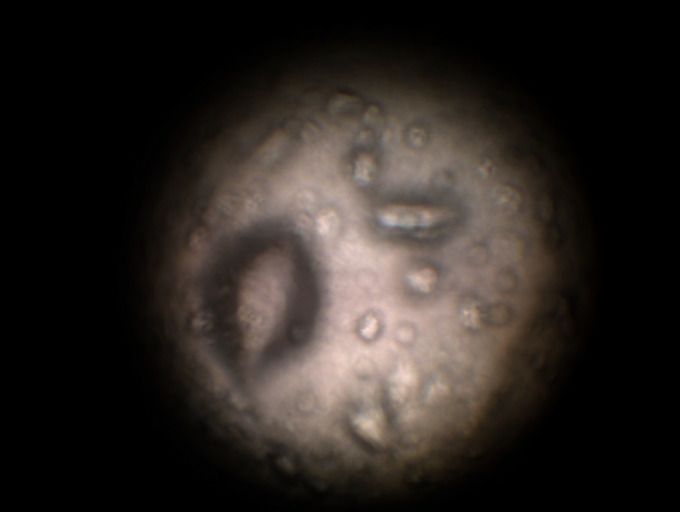
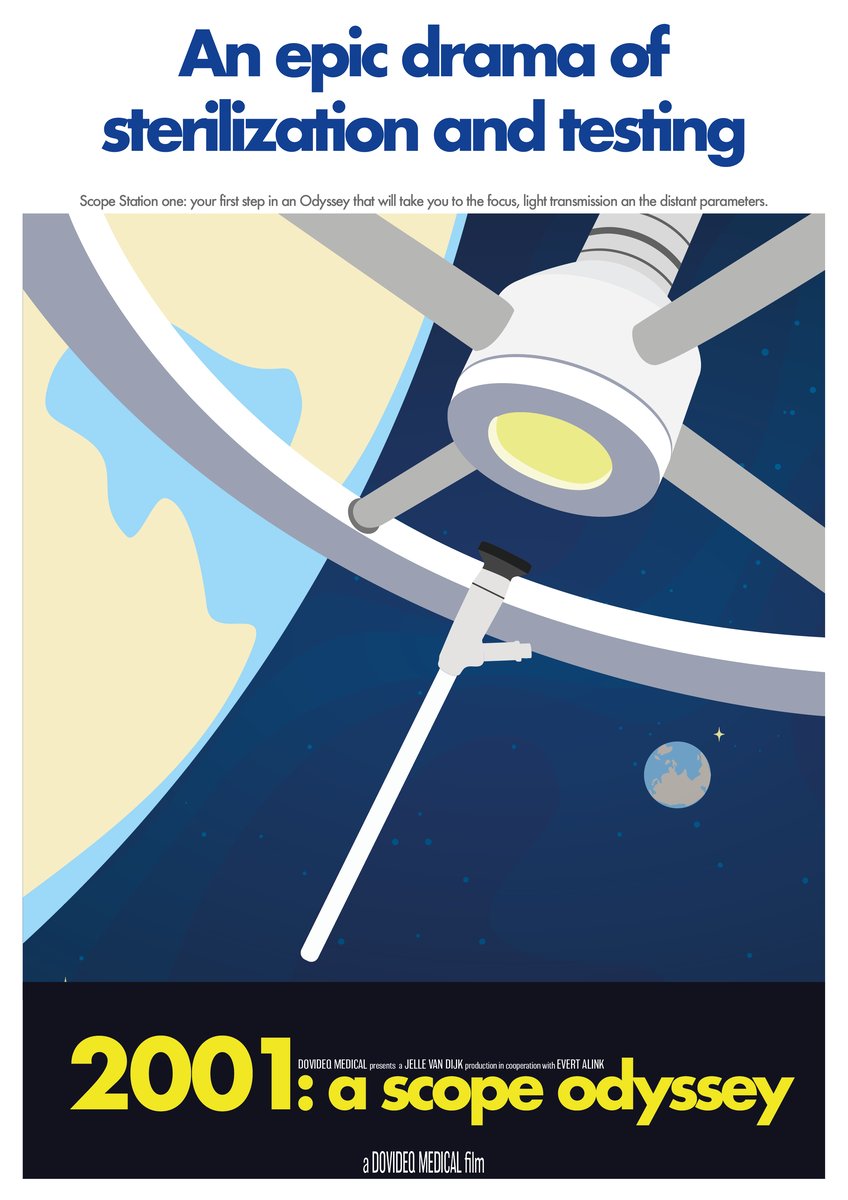
Technischer Beratungsservice für